In der praktischen Anwendung von DTF-Pigmentweißtinten gilt die Behauptung “keine Sedimentation” als falsche Aussage. Der Kern liegt in den unvereinbaren Widersprüchen zwischen den physikalischen Eigenschaften von Titandioxid, den funktionalen Anforderungen der Tinte und den Gesetzen der Materialwissenschaft – Sedimentation ist ein thermodynamisch spontaner Trend, und bestehende Technologien können sie nur verzögern, nicht vollständig beseitigen. Dies kann in folgenden vier Aspekten erklärt werden
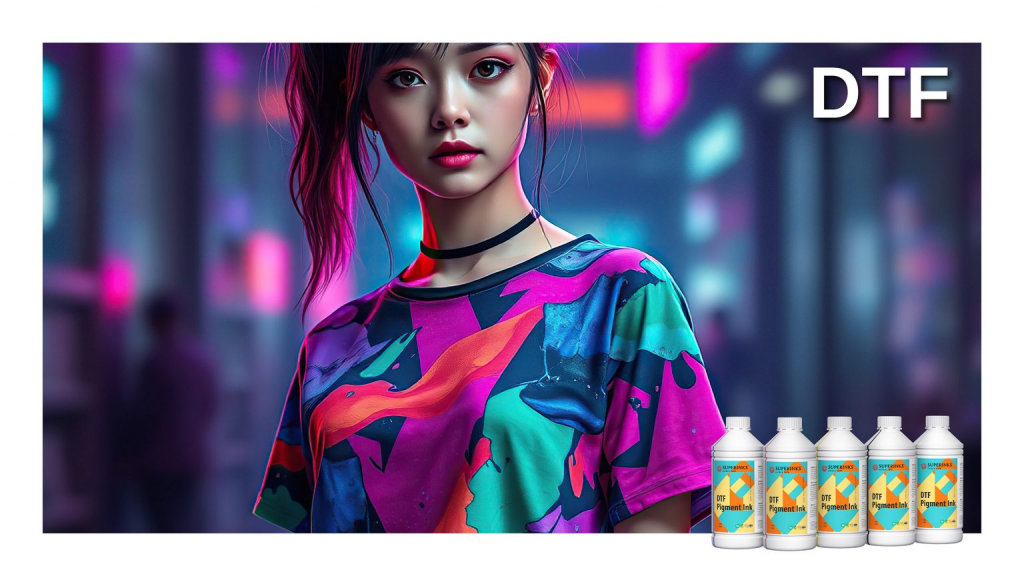
1. Die physikalischen Eigenschaften von Titandioxid bestimmen, dass “Sedimentation ein spontaner Trend ist”
Titandioxid (insbesondere Rutil-Typ) hat eine Dichte von ca. 4,2 g/cm³, während das Lösungsmittelsystem (Wasser, Alkohole etc.) von Weißtinten für den Thermotransfer nur eine Dichte von 1–1,2 g/cm³ aufweist, mit einem Dichteunterschied von mehr als dem Dreifachen. Gemäß dem Stokes’schen Sedimentationsgesetz:
Die Sedimentationsgeschwindigkeit von Partikeln ist proportional zur Dichtedifferenz zwischen Partikeln und Lösungsmittel und umgekehrt proportional zur Viskosität des Lösungsmittels.
Dies bedeutet, dass Titandioxidpartikel in der Tinte aufgrund der Schwerkraft unweigerlich eine Tendenz zur Sedimentation haben. Solange es einen Dichteunterschied gibt, ist es unmöglich, diesen thermodynamisch spontanen Sedimentationstrend durch Materialien vollständig auszugleichen. Selbst wenn Partikel mit Dispergiermitteln auf Nanogröße (z.B. unter 100 nm) dispergiert werden, um die Kurzzeitstabilität zu verbessern, führt langes Stehen (über einen Monat) aufgrund von “geschwächter Brownscher Bewegung und langsamer Agglomeration” immer noch zu einem allmählichen Absinken der Partikel, was zu irreversibler Sedimentation führt. Es ist nur eine Frage der Zeit.
2. Es besteht ein natürlicher Widerspruch zwischen den Anforderungen “Fließfähigkeit” und “Sedimentationsverhinderung” der Tinte
Weißtinten für den Thermotransfer müssen die Anforderung der Druckflüssigkeit erfüllen: Die Düsenöffnung beträgt typischerweise 20–50 μm, daher darf die Tintenviskosität nicht zu hoch sein (i.d.R. 10–30 mPa·s für wässrige Systeme und 5–15 mPa·s für ölige Systeme); andernfalls verstopft sie die Düse oder verursacht ungleichmäßiges Ausstoßen.
“Sedimentationsverhinderung” erfordert jedoch hohe Viskosität oder starke strukturelle Unterstützung (wie thixotrope Systeme), und hohe Viskosität steht in direktem Konflikt mit der Druckflüssigkeit:
- Wenn die Viskosität deutlich erhöht wird, um Sedimentation zu verhindern (z.B. über 50 mPa·s), kann die Tinte nicht reibungslos durch die Düse ausgestoßen werden und verliert ihre Druckfunktion;
- Wenn man sich nur auf die Ladung oder sterische Hinderung von Dispergiermitteln verlässt, kann zwar niedrige Viskosität beibehalten werden, aber Partikel setzen sich aufgrund der Dichtedifferenz langsam ab, insbesondere im Ruhezustand, da Scherkräfte zur Zerstörung von Agglomeration fehlen.
Dieser “Funktionskonflikt” bestimmt, dass die Tinte einen Kompromiss zwischen “Druckbarkeit” und “Sedimentationsverhinderung” eingehen muss. Es ist unmöglich, absolute Sedimentationsfreiheit auf Kosten der Druckleistung zu verfolgen, daher kann Sedimentation nur verzögert, nicht beseitigt werden.

3. Die Rolle von Additiven ist “Verzögerung”, nicht “Beseitigung”, mit inhärenten Grenzen
Die Kernfunktion bestehender Anti-Sedimentationsmaterialien (Dispergiermittel, Suspensionsmittel etc.) besteht darin, den Sedimentationszyklus zu verlängern, aber sie können physikalische Gesetze nicht durchbrechen:
1. Begrenzte Adsorptionsstabilität von Dispergiermitteln: Dispergiermittel werden durch physikalische Adsorption (selten chemisch) auf der Oberfläche von Titandioxid adsorbiert. Ändert sich das Tintensystem (z.B. pH-Schwankung, Temperaturanstieg oder Lösungsmittelverdunstung), können Dispergiermittel desorbieren. Zum Beispiel:
- In Umgebungen mit niedriger Temperatur kräuseln sich die Molekülketten der Dispergiermittel, schwächen die sterische Hinderung und machen Partikel anfällig für Agglomeration;
- Nach langer Lagerung können einige Dispergiermittel durch Verunreinigungen auf der Titandioxidoberfläche (wie Eisenionen, Calcium- und Magnesiumionen) “konkurrierend adsorbiert” werden und ihre Dispergierwirkung verlieren.
2. Die strukturelle Unterstützung von Suspensionsmitteln zerfällt mit der Zeit: Die thixotropen Netzwerke, die von Xanthangummi, pyrogener Kieselsäure usw. gebildet werden, haben nach langem Stehen oder wiederholtem Einfrieren/Tauen allmählich gelockerte Wasserstoffbrückenbindungen oder Partikel-Partikel-Kräfte, was die Netzwerkstrukturfestigkeit verringert. Folglich schwächt die “Bindungskraft” auf Titandioxid und führt schließlich zur Sedimentation.
3. Hoher Titandioxidgehalt verstärkt Instabilität: Um Deckkraft zu gewährleisten, enthalten Weißtinten für den Thermotransfer typischerweise 20 %–40 % Titandioxid, viel mehr als in normalen Tinten (5 %–15 %). In hochkonzentrierten Partikelsystemen ist der Partikelabstand kürzer, die Kollisionswahrscheinlichkeit höher und das Agglomerationsrisiko nimmt mit der Zeit exponentiell zu. Selbst bei perfekter anfänglicher Dispersion sind lokale Agglomeration und Sedimentation nach mehreren Monaten unvermeidlich.
4. Die Komplexität praktischer Anwendungsszenarien beschleunigt die Unvermeidbarkeit der Sedimentation
Es gibt viele Variablen in den Lager-, Transport- und Einsatzumgebungen von Weißtinten für den Thermotransfer, die die Unvermeidbarkeit der Sedimentation weiter verstärken:
- Temperaturschwankungen: Hohe Temperaturen im Sommer (über 30 °C) beschleunigen Lösungsmittelverdunstung und Dispergiermittelalterung; niedrige Temperaturen im Winter (unter 0 °C) können Suspensionsmittel gefrieren lassen und destabilisieren, wodurch die Systemstabilität zerstört wird;
- Mechanische Vibrationen: Erschütterungen während des Transports können Titandioxidpartikel unter Scherkraft agglomerieren lassen, wodurch sie nach dem Stehenlassen anfälliger für Sedimentation werden;
- Offene Verwendung: Beim Drucken ist die Tinte der Luft ausgesetzt, und Lösungsmittelverdunstung erhöht die Titandioxidkonzentration, wodurch das Agglomerationsrisiko steigt.
Diese unkontrollierbaren Faktoren in praktischen Szenarien machen “absolute Sedimentationsfreiheit” in industriellen Anwendungen völlig unerreichbar. Selbst wenn unter Laborbedingungen kurzfristig keine Sedimentation auftritt, tritt Sedimentation im tatsächlichen Umlauf unweigerlich auf
Schlussfolgerung: “Sedimentfrei” verstößt gegen die Gesetze der Materialwissenschaft und ist ein idealisiertes Missverständnis
“Keine Sedimentation” bei Weißtinten für den Thermotransfer ist im Wesentlichen ein idealisiertes Ziel, das gegen die Gesetze der Thermodynamik und Strömungsmechanik verstößt. Die Dichtedifferenz zwischen Titandioxid und Lösungsmitteln, die Druckflüssigkeitsanforderungen der Tinte und die Grenzen der Additive bestimmen gemeinsam, dass Sedimentation ein “unvermeidlicher Trend” ist. Bestehende Technologien können den Sedimentationszyklus nur verlängern, um praktische Anforderungen zu erfüllen (z.B. keine sichtbare Sedimentation innerhalb von 1–3 Monaten, die durch Schütteln vor Gebrauch wiederhergestellt werden kann).
Daher ignorieren Weißtinten für den Thermotransfer, die “sedimentfrei” behaupten, entweder das reale Szenario der Langzeitlagerung oder opfern die Druckleistung (z.B. ultrahohe Viskosität, die sie unbrauchbar macht), und Probleme werden in Anwendungen unweigerlich auftreten.